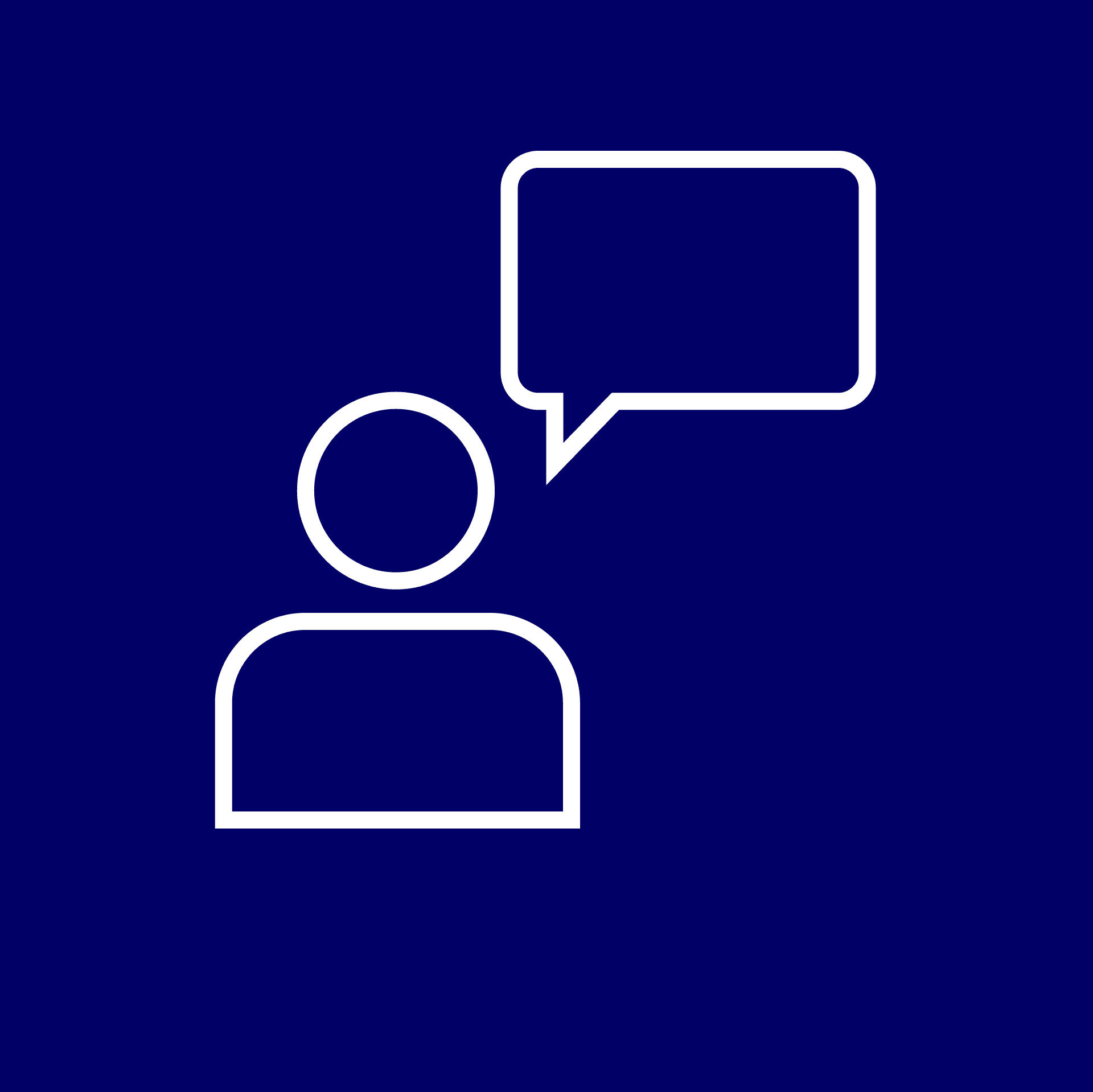Flüssiggas auf Berghütten
Energieversorgung, die oben ankommt
Gewusst wie: Energieversorgung für Berghütten
Die Energieversorgung auf Berghütten stellt Planer und Betreiber vor besondere Herausforderungen, denn oft liegen diese Hütten abgelegen und sind nicht ganzjährig oder uneingeschränkt mit Fahrzeugen erreichbar. Auch die teils extremen Witterungsbedingungen erschweren eine sichere unterbrechungsfreie Energieversorgung. Gleichzeitig gilt es, den sensiblen Naturraum zu schützen und den Bedürfnissen von Bergsportlern gerecht zu werden. In diesem Spannungsfeld sind innovative, verlässliche Lösungen gefragt.
Tyczka Energy hat zu diesem spannenden Thema mit Xaver Wankerl vom DAV gesprochen. Er ist dort verantwortlich für Hüttenbau und –technik.
Der Deutsche Alpenverein e.V. (DAV) ist die größte nationale Bergsteigervereinigung weltweit und anerkannter Naturschutzverband. Er setzt sich für den Erhalt der Naturwelt der Alpen und Mittelgebirge ein. Eine wichtige Aufgabe ist dabei der Brückenschlag zwischen dem Schutz der Natur und den Interessen der Bergsportler, wie ein Spagat zwischen Infrastruktur in den Alpen und Erhalt der Umwelt.
Die Energieversorgung von Berghütten spiegelt dies wider: Der Betrieb muss reibungslos und sicher laufen, damit die Bedürfnisse der Hüttengäste erfüllt werden. Und zugleich soll die Umwelt so wenig wie möglich durch Emissionen belastet werden.
Tyczka Energy: Wie viele Hütten hat der DAV?
Xaver Wankerl: Wir haben 323 öffentlich zugängliche Hütten, sowohl in den Alpen als auch in den Mittelgebirgen. Einige sind talnah, rund 120 mit einer Gehzeit von unter einer Stunde, der Rest ist weiter abgelegen und oft auch nicht mit Fahrzeugen anzufahren.
Darüber hinaus gibt es noch jede Menge Sektionshütten, die von den ca. 350 Sektionen in Eigenregie geführt werden. Viele davon sind Selbstversorgerhütten und nicht öffentlich zugänglich.
Welche Aspekte müssen grundsätzlich bei Bau oder Sanierung von Hütten beachtet werden?
Da gibt es drei wesentliche Bereiche: die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und natürlich die Energieversorgung.
Das knappste Gut für Hütten ist Wasser. Hier sind wir oft auf Schmelzwasser aus Schnee sowie Regenwasser angewiesen. Über verschiedene Schritte wird es gesammelt, gelagert, zu Trinkwasser aufbereitet, als solches gespeichert und zur Verfügung gestellt. Für diese Schritte wird Strom benötigt.
Was uns gleich zum Thema Energieversorgung bringt. Was ist für den Alpenverein die
Zwei wesentliche Punkte sind zu berücksichtigen: die CO2-Bilanz und dass der Energieträger nicht wassergefährdend ist.
Am liebsten wäre uns eine vollständig autarke Selbstversorgung unserer Hütten. Mit Sonnenenergie alleine wird das schwierig. Mit Wasserkraft können wir das auf einigen Hütten schon umsetzen. Das geht natürlich nur, wenn die Hütte an einem geeigneten Wasserlauf liegt.
Welche Energiealternativen setzt der Alpenverein denn ein?
Biogene Energie steht an oberster Stelle und so versorgen wir schon über 60 Hütten mit Rapsöl. Das Technologie- und Förderzentrum TFZ, Straubing, bewertet Rapsöl als sinnvolle Kraftstoffalternative für den Antrieb von z.B. Blockheizkraftwerken. Und diese sind die Energiezelle auf den Hütten, denn sie produzieren gleichzeitig Strom und Wärme.
Rapsöl hat zusätzlich den Vorteil, dass es in Kanistern transportiert und gelagert werden kann. Und über die Materialseilbahn bequem zur Hütte gelangt. Es wird bei niedrigen Temperaturen zwar fest, doch die Technik ist so ausgereift, dass der Betrieb auch im Winter sichergestellt ist.
Welche Rolle spielt Flüssiggas für die Energieversorgung von Berghütten?
Eine gar nicht so kleine Rolle, denn in den Küchen ist es sowieso schon oft im Einsatz. Meist als 33 kg Gasflasche, die gut mit einer Materialseilbahn transportiert werden kann. Wenn Flüssiggas schon in der Küche verwendet wird, liegt es nahe, auch das Blockheizkraftwerk damit zu betreiben. Hier kann dann der Energienachschub die Herausforderung sein, denn wie eingangs schon erwähnt: circa die Hälfte unserer Hütten sind nicht mit einem Tankfahrzeug erreichbar.
Auch unter Umweltgesichtspunkten ist uns Flüssiggas die liebste fossile Energie. Denn es hat sehr niedrige Emissionswerte und darf daher auch in Wasserschutzgebieten eingesetzt werden. Damit erfüllen wir unseren selbstgesetzten Anspruch nach größtmöglichem Umweltschutz.
Vielen Dank Herr Wankerl. Ihre Worte lassen erahnen, dass die Infrastruktur einer Berghütte alles andere als banal ist.
Tyczka Energy versorgt auch Hütten, die nicht zum DAV gehören. Zwei Beispiele aus dem Allgäu und dem Bayerischen Wald zeigen, wie eine sichere Versorgung mit Flüssiggas unter anspruchsvollen Bedingungen funktioniert – durchdacht und zukunftsorientiert.
Alpe Hohenegg - Location mit Weitblick
Was für ein Blick! Die im Skigebiet der Imbergbahn gelegene Alpe Hohenegg überrascht ihre Besucher mit einem faszinierenden Ausblick ins Oberallgäu. Allein dieses Panorama wäre schon Grund genug, hierher zu kommen, doch der einladende Berggasthof bietet noch vieles mehr. Seit 2015 bewirtschaften Nikola und Carsten Schmahl den Gebäudekomplex, der im Jahr 2009 auf einer traditionellen Alpe komplett neu errichtet wurde. Im Bettenhaus des Berggasthofs gibt es insgesamt 56 Betten, verteilt auf zwölf moderne, familienfreundliche Zimmer, jeweils ausgestattet mit Dusche und WC. Darüber hinaus stehen ein Seminarraum, ein Trockenraum mit Schuhtrockner sowie ein Skidepot zur Verfügung.
Auf der Gartenterrasse können bis zu 200 Personen unter freiem Himmel sitzen und im Restaurant Hohenegg ist Platz für bis zu 120 Gäste.
Weitblick – nicht nur für das Auge, sondern auch bei der Planung
Damit der Betrieb reibungslos läuft, muss die Energieversorgung natürlich zuverlässig laufen. Im Winter ist die Alpe nur zu Fuß oder über die Imbergbahn erreichbar, somit können auch Tankwagen das Gelände über mehrere Monate hinweg nicht anfahren.
Dies musste natürlich 2009 bei der Planung des Energiekonzepts im Rahmen der Umbauarbeiten berücksichtigt werden. Die Lösung: eine Flüssiggasanlage mit vier unterirdisch eingelagerten 2,9-Tonnen-Tanks. Diese liegen alle in einer Reihe und sind über eine gemeinsame Leitung verbunden, die wiederum zu jeweils einer Gastherme im Haupthaus und im Nebenhaus führt. Auch wenn die einzelnen Tanks „nur“ 2,9 Tonnen fassen, zählt bei diesem Konzept die Gesamtmenge an Flüssiggas, und somit ist die Anlage nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungspflichtig. Doch der Vorteil der maßgeschneiderten Lösung liegt auf der Hand: Denn mit dieser Anlage ist die Alpe selbst im längsten Winter stets sicher und gut versorgt.

Der Große Falkenstein - Modernes Energiekonzept auf 1.315 Meter Höhe
Der Große Falkenstein, inmitten des Bayerischen Wald gelegen, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Biker. Und für Michael Garhammer, den Hüttenwirt, ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz, der viele Herausforderungen bietet.
Neubau mit energetischer Sanierung nach knapp 100 Jahren
Als Garhammer 2011 erstmals Wirt und Pächter am Großen Falkenstein wurde, hätte er es sich nicht träumen lassen, einmal so komfortabel am Berg zu wohnen.
Das alte Schutzhaus stammte von 1932/33, war mehrfach umgebaut worden und wies schon einige gravierende Bauschäden auf. Mit Strom und Kachelofen beheizt, überalterten Sanitärinstallationen, mangelndem Brandschutz und Massenschlafräumen entsprach es nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die geplante Kernsanierung kratzte stark an den Kosten für einen Neubau. Deshalb machte der Wald-Verein, Eigentümer der Schutzhütte, lieber Nägel mit Köpfen und errichtete mit großem – auch ehrenamtlichen – Engagement ein neues Schutzhaus.
Jetzt empfangen zehn helle Zimmer die Wanderer, in denen vier Personen Platz finden. Überall im Haus duftet es nach Holz, die Gaststube bietet ein riesengroßes Panoramafenster für den Blick nach draußen. So modern wie sie wirkt hat sie doch etwas Anheimelndes: durch das geschickt eingefügte Altholz und den wunderschönen Kachelofen des alten Schutzhauses, der hier wieder seinen Ehrenplatz gefunden hat.
Flüssiggas für die sichere Energieversorgung der Hütte
Beheizt wird das Gebäude durch Flüssiggas von Tyczka Energy. Diese Wahl hat für die exponierte Lage entscheidende Vorteile. Denn im Winter muss Brennstoff-Vorrat für gut sieben Monate verfügbar sein, wenn Tanklastwagen das Schutzhaus nicht erreichen können. Etwaige Alternativen wie Hackschnitzel oder Pellets kamen nicht in Frage, da deren Lager-Bunker viel zu groß geworden wären. Der 6.000 Liter Flüssiggas fassende Tank dagegen braucht wenig Platz und verschwand einfach unter der Erde neben dem Gebäude.
Ein weiteres Argument für die Flüssiggas-Heizung ist neben ihrer Umweltverträglichkeit der unproblematische Betrieb. Es kann schon mal vorkommen, dass das Haus bei Sturm oder Schneebruch vom Tal nicht mehr erreichbar ist. Da muss die Technik bis zu drei Wochen auf sich allein gestellt zuverlässig funktionieren.

Sie möchten mehr wissen über die Energieversorgung von Berghütten?
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören